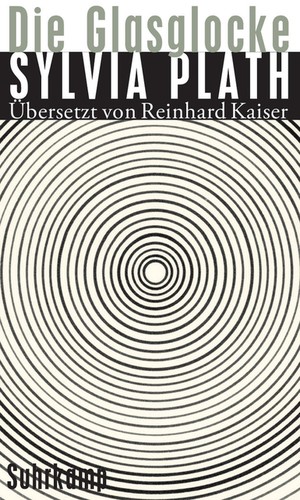AnnaCarina hat Die Glasglocke von Sylvia Plath besprochen
Review of 'Die Glasglocke' on 'Goodreads'
4 Sterne
Plath zeichnet eine Person, Esther, die ohne emotionale Empathie sich selbst und ihrem Umfeld gegenüber, den sozialen Bedingungen der 50er Jahre entgegentritt. Normen, Konformismus, die Rolle der Frau, Interaktion zwischen den Geschlechtern, Erwartungshaltungen, Beruf, Alltag und der Umgang mit psychologisch auffälligem Verhalten. Für Esther ist es eine destruktive, feindliche Umwelt.
Ihre Empathie beschränkt sich auf kognitive Fähigkeiten.
Sie lässt ihre Freundin besoffen in ihrer Kotze vor der Tür liegen. Kümmert sich nicht. Kein schlechtes Gewissen. Keine emotionale Regung. Ihr Freund ist an Tb erkrankt. Sie freut sich sogar darüber, weil er nicht mehr rein ist ( hat vor ihr schon rumgevögelt, ein no Go). Null emotionale Anteilnahme an seiner Erkrankung. Alles was eigentlich im emotionalen Spektrum statt finden müsste, weist bei ihr mechanische Reaktionen auf.
Sie ist intelligent. Sie beobachtet scharf, ordnet ein, reflektiert, auf einer rein rationalen, kognitiven Ebene des Verstandes. Sie weint durchaus. Als Stress oder Überforderungsreaktion auf sozialen Druck. Abbau von Anspannung. Am Grab ihres Vaters. Als persönliche Identifikation. Die Erinnerung an den Verlust. Was hat sie verloren? Liebe, Wärme, Nähe, Verständnis, Zuneigung?
Nein. Dinge die rein kognitiv verarbeitet werden:
„ es schien angemessen, dass ich das Trauen übernahm“, „ er hätte mir alles über Insekten beigebracht. Er hätte mit Latein und Griechisch beigebracht“, „ich wusste nicht warum ich heftig weinte….ich jaulte meinen Verlust in den kalten Salzregen“.
Solch eine Psyche versucht nun den Zwängen zu entkommen. Den Todestrieb und innere Leere im Gepäck ist das keine risikoarme Nummer der Ratio, in die Freiheit auszubrechen, die uns hier erwartet.
Die Beste Szene ereignet sich in diesem Kontext auf der Skipiste. Eine Szene der Intensität. Einreißen jeglicher Grenzen, Überwindung des Selbst → Lebensgefahr.
Plath arbeitet mit szenischen Bildern, die direkt in einer Situation starten und diese zügig durchlaufen. Wir bekommen einen Wirbel an Vergangenheits- und Gegenwartsmomenten, in denen Esther durch ihren eingeschränkten Charakter, äußerst vorhersehbar interagiert. Ihre Reaktionen überraschen mich nicht, da die Spontanität der Emotionalität fehlt.
Insofern stellen sich die Szenen für mich irgendwann als redundant ein. Die Art und Weise wie Esther sich verhält und handelt, bzw. nicht handelt ist vorhersehbar. Ihre Gedanken kreisen um immer dieselben Themen: Beruf, Entjungferung, Ehe. Sie spricht immer nur von Zielen und Vorstellungen. Es kommen keine neuen Aspekte hinzu, da sie schlicht nicht in der Lage ist diese zu liefern. Insofern könnten beliebig andere Szenen gesetzt werden, da Esther nicht komplex genug daher kommt, um für mich interessant zu bleiben. Ihre Figur nutzt sich zu schnell an.
Plath bleibt in der Icherzählerperspektive. Weshalb das Buch nach etwa 70% auf der Plotebene mit der Anlage des Charakters und Erzählinstanz ausgedient hat. Neue Reize sind nicht zu erwarten.
Moment, da ist ja noch die Sprache.
Die ist erste Sahne. Ein fließendes, immersives Stück, aus einem Guss. Sie spielt mit Wörtern, Bedeutungen und bricht die symbolische Ordnung, die Glasglocke auf. Sie trägt über die Handlung hinaus und bedeutet Widerstand gegen Esthers Todestrieb, dem Verzweifeln und Abprallen an ihrer Umwelt. Die Sprache leuchtet, spendet Wärme, Geborgenheit und emotionale Empathie. Sie schließt die Lücke in Esthers Dezentriertheit. Woran Realität scheitert, Menschen in Esthers Umfeld und sie selber scheitern - Integration, Hinsehen – offenbart die sprachliche Ebene.
Welche Art von Leser bin ich?
Nehme ich nur die Sprache, die Literatur als künstlerischen Ausdruck, gegen die deterministische Anlage der Person Esthers und ihres Umfeld, erlebe ich einen Öffnungsmoment. Die Sprache durchschreitet jegliche Zwänge und gibt Esther die Empathie, Freiheit und das Ja zum Leben, vollumfänglich zurück. Sie vervollständigt sie.
Esthers Psychologie ist allerdings Teil dieser Literatur. Dieser Kunst. Deshalb war es mir zu Beginn wichtig die Empathie auszudifferenzieren und Esthers Verhalten zu plausibilisieren.
Nehme ich Esther dann in ihren Handlungen, wie sie sich gestaltet in diese Rechnung mit hinein, wird die Sprache zur Suggestion. Sie scheint zu transformieren, vermag es aber nicht, da Esther sich nun mal nicht dementsprechend verhält. Sie transformiert nicht, da die Sprache in ihrer Realität sie nicht vervollständigen kann. Ihre Konstitution gibt dies nicht her. Die Sprache dient dem Leser, Esther bleibt wo sie ist und langweilt mich (als literarische Figur). Für mich fehlen hier stilistische Mittel, erweiterte Erzählperspektiven um diesen Mangel auszugleichen.
Ich bin nur in der Lage diesen Text sehr gut zu finden, wenn ich Esther und ihre Handlungen ins Abstrakte hole und sie sich mit der Sprache Plaths einen Prozess unterziehen lassen.
Bin ich als Leser dazu nicht in der Lage, scheitert der Text in all seinem Glanz an der Setzung des Charakters und bleibt in seiner eigenen Glasglocke hängen.
Besser schaffe ich es augenblicklich nicht, meine eigene Zerrissenheit dem Text gegenüber zum Ausdruck zu bringen.
Da ich immer auf der Seite der Transformation und des Prozesses bin, versuche ich mich ins Abstrakte vorzuwagen und gebe grummelnde Sonderpunkte für Plaths sprachlichen Widerstand.