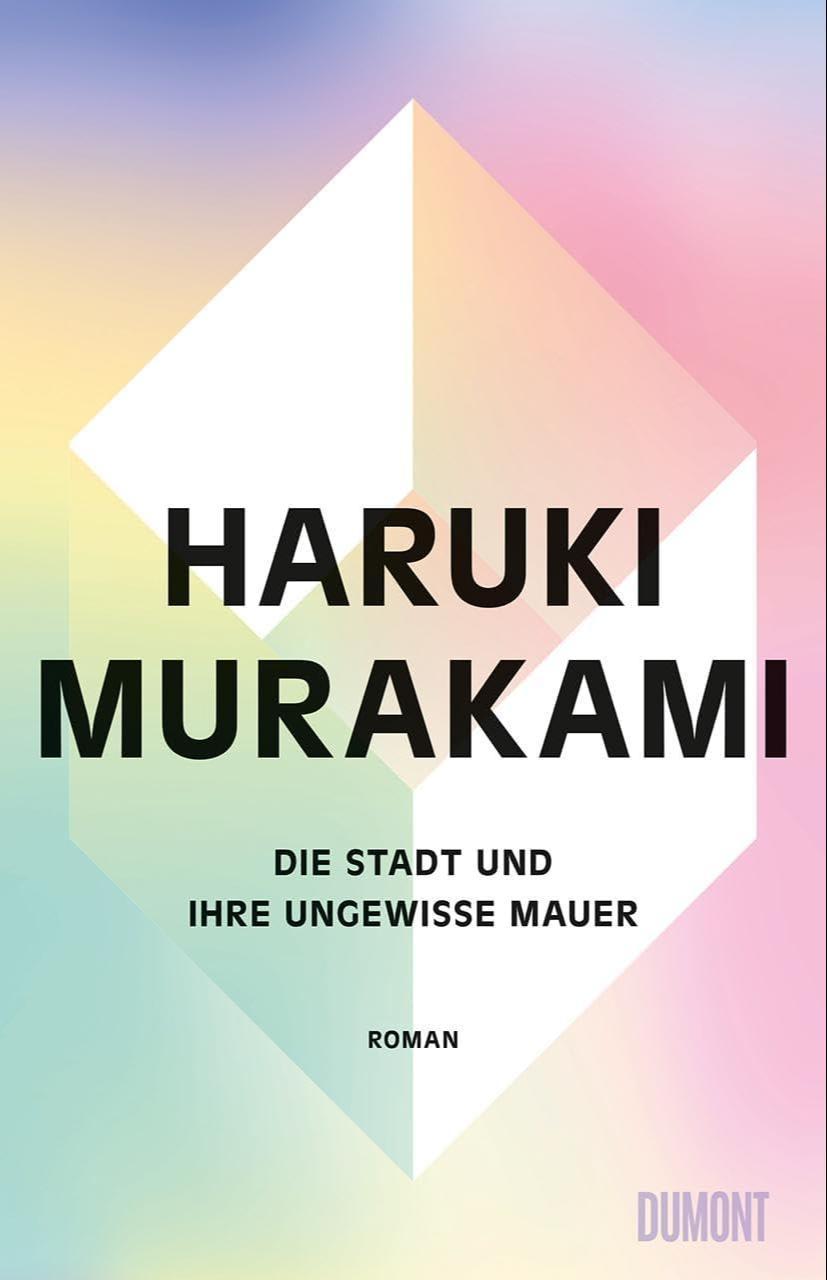AnnaCarina hat Die Stadt und ihre ungewisse Mauer von Haruki Murakami besprochen
Review of 'Die Stadt und ihre ungewisse Mauer' on 'Goodreads'
2 Sterne
2,5 Sterne
Oh! Darling
Please believe me
I’ll never do you no harm
Believe me when I tell you
I’ll never do you no harm
Oh Darling
If you leave me
I’ll never make it alone…
[Beatles]
Murakami beweist mit diesem Buch wieder einmal seinen Blick und Hingabe für die Außenseiter der Gesellschaft. Leise Menschen, die im Lärm der Anderen untergehen. Die Beschädigten, voller Schmerz und Angst, vor sich selbst. Angst einen anderen zu beschädigen.
Er entführt uns in eine Art Nirwana der Friedfertigkeit. Das Buch ist von Anfang bis Ende ein Rückzug aus der Realität in die Illusion. Die Logik, die in der die Welt der Sprache angesiedelt ist, deren Grenzen, die Grenzen meiner Welt ausmachen, setzt Murakami aus.
Der Junge im Yellow-Submarine-Pullover liest Wittgensteins tractatus parallel zur isländischen Sagenwelt.
Die Ratio weicht der Intuition.
Die Welt der symbolischen Ordnung, der Sprache und Kultur, der sozialen Ordnung fordert ihren Tribut. Fragmentierung des Selbst, ein Gefühl des Mangels, Verlust des direkten Zugangs zu den wahren Wünschen und Bedürfnissen.
Dieser Mangel wird in voller Anerkennung von Murakami bespielt.
Und jetzt wird es problematisch. Ein Fosse in „Der Andere Name“ hat das gleiche Ziel: Hinein ins Reale, ran ans Unaussprechliche, Unmögliche. Auflösung der symbolischen Ordnung. Dafür müssen unsere Figuren feststecken, eine innere Erstarrung durchleben. In Mumis Fall durch das Nirwana der Friedfertigkeit bespielt. Dies muss zur Folge haben, dass die Welt in vereinfachte, dichotome Kategorien unterteilt ist. Fosse löst dies auf höchster literarischer Sprach- und Stilebene. Murakami löst dies, indem er uns eine Fahrt auf dem Kinderkarussel gewährt.
Es kommen solche Dialoge dabei rum:
„Vielleicht sehnten Sie sich tief in ihrem Herzen danach, die Stadt zu verlassen und auf diese Seite zurückzukehren.“
„Das würde also bedeuten, dass dieser Wille der stärker ist als mein eigener, nicht außerhalb von mir war, sondern in mir selbst?“
„Das ist natürlich nur eine haltlose persönliche Vermutung von mir. Aber nach Ihrer Geschichte kann ich es mir nicht anders vorstellen. Wahrscheinlich sind Sie freiwillig in diese unheimliche Stadt gegangen und aus freien Stücken zurückgekehrt. Diese Feder, die Sie zurückkatapultiert hat, muss eine besondere Kraft in Ihnen selbst sein. Der starke Wille tief in Ihnen hat dieses große Kommen und Gehen möglich gemacht. Auf einem Gebiet, das über Ihre Logik und Vernunft hinausreicht.“
„Woher wissen Sie das?“
„Das ist nur meine persönliche Meinung. Vielleicht stimmt es nicht. Aber ich habe es irgendwie im Urin (auch wenn es zweifelhaft ist, dass die Seele eines Verstorbenen Urin birgt).
Ja, so könnte es gewesen sein. Natürlich passiert es nicht jedem. Aber irgendwo und irgendwann kann es passieren. Wenn man einen starken Willen und ein reines Herz hat.“
Das Buch unterfordert maßlos. Es funktioniert aber über weite Strecken.
Insbesondere dort, wo wir in die Lebensgeschichten der Figuren abtauchen, den Jungen mit dem Yellow-Submarine-Pullover verfolgen, die Winterstimmung, die Atmosphäre in der Bibliothek in uns aufsaugen. Es ist so pastell: uneindeutig, zart, schwebend, fluffig, liebevoll, friedvoll.
Murakami verweigert sich sprachlich dem Schmerz. Er will heilen, weiß aber nicht wie.
Man gleitet fröhlich auf dieser rosa Zuckerwatte vor sich hin, bis „der Lauch im Bett“, einen mit einem Gongschlag zurückholt oder vor Zuckersirup triefende Tränke (Weisheiten) eines wirren Mirakulix gereicht werden – Sprachkitsch vom Feinsten.
Murakami arbeitet erstaunlich plakativ die Symbolik heraus. Ich kenne es von seinen Büchern, dass ich seinen magischen Realismus in der Imagination oft nicht kapiere. Er lässt es für sich stehen. Hier erklärt er ihn. Dies führt ua. zu diesen äußerst skurrilen Dialogen und Gedanken, die sich kindlich, naiv, vereinfacht darstellen. Ich verweise hier auf meinen Punkt des Feststeckens und der Konsequenz daraus zu Vereinfachen. Er muss dies so anlegen, um die Dauerflucht ins Imaginäre aufrechtzuerhalten. Dadurch verliert er den Anspruch und literarische Qualität. Den Preis den er für seine stilistischen, sprachlichen Entscheidungen zahlt, wie er die Vermittlung des Unbewussten angeht, das der Symbolisierung widersteht, ist meines Erachtens zu hoch.
Das Buch ist in 3 Teile gegliedert. Mit Teil 1 stolpert er äußerst unbeholfen in die Stadt mit der Mauer. Fällt mit der Tür ins Haus. Da rumpelt es sprachlich und kompositorisch übelst hart.
Teil 2 ist der längste und geglückt. Die von mir erwähnten Ausreißer ausgenommen.
Teil 3 schließt in sich das Buch rund ab und tunkt mich zum Ende nochmal tief in eingekochten Sprachkitsch, der klassisch philosophische Ideen in sprühendes, wirr tanzendes Konfetti der Selbstfindung verwandelt.
Ich muss mal warten wie gut das Buch einwirkt und was es noch mit mir macht, um über 3 Sterne nachzudenken. 2 Sterne sind hart. Ich weiß.