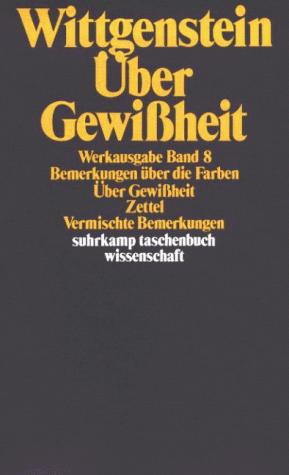AnnaCarina hat Über Gewißheit. von Ludwig Wittgenstein besprochen
Review of 'Über Gewißheit.' on 'Goodreads'
"Über Gewißheit" beendet.
Zettel, über Farben, vermischte Bemerkungen folgen irgendwann.
Ich bewerte das bewusst nicht, weil ich keinen wirklichen Zugang zur Problematik habe, die Wittgenstein versucht zu umkreiseln. Mir stellen sich die aufgeworfenen Fragen und Problemstellungen der Sprachspiele in der Form nicht.
Ich sehe ihn hier klar zwischen den Stühlen (Hegel, Plato) sitzen und etwas hilflos über den Zweifel, Gewissheit und was gewusst werden kann, durch unsere Sprachspiele holpern.
Diese fragmentarische Schreibweise in aphoristischer Form funktioniert ganz gut, um keine lineare Argumentation vorzubringen. Die Vielfältigkeit der Perspektiven und Interpretationen kommt schön durch. Wer hier auf irgendeine festgelegte Sichtweise hofft, wird enttäuscht. Wittgenstein kämpft hart darum, Bedingungen oder Ausgangspunkte zu finden unter denen man wissen kann, der Wissensbegriff keine Anwendung findet, der Zweifel begründet oder unsinnig erscheint und wann der Zweifel mal zum Ende kommen muss. Die Rolle des Wesens von Zweifel und Gewissheit wird von ihm in unseren Sprachspielen unter …
"Über Gewißheit" beendet.
Zettel, über Farben, vermischte Bemerkungen folgen irgendwann.
Ich bewerte das bewusst nicht, weil ich keinen wirklichen Zugang zur Problematik habe, die Wittgenstein versucht zu umkreiseln. Mir stellen sich die aufgeworfenen Fragen und Problemstellungen der Sprachspiele in der Form nicht.
Ich sehe ihn hier klar zwischen den Stühlen (Hegel, Plato) sitzen und etwas hilflos über den Zweifel, Gewissheit und was gewusst werden kann, durch unsere Sprachspiele holpern.
Diese fragmentarische Schreibweise in aphoristischer Form funktioniert ganz gut, um keine lineare Argumentation vorzubringen. Die Vielfältigkeit der Perspektiven und Interpretationen kommt schön durch. Wer hier auf irgendeine festgelegte Sichtweise hofft, wird enttäuscht. Wittgenstein kämpft hart darum, Bedingungen oder Ausgangspunkte zu finden unter denen man wissen kann, der Wissensbegriff keine Anwendung findet, der Zweifel begründet oder unsinnig erscheint und wann der Zweifel mal zum Ende kommen muss. Die Rolle des Wesens von Zweifel und Gewissheit wird von ihm in unseren Sprachspielen unter die Lupe genommen. So richtig vom Fleck kommt er dabei leider nicht. Das liegt m.E. an der "Stotterdynamik" (meine Eigenkreation), die er dem Flussbett, der Sprachspiele auferlegt. Ein Hybrid aus Dynamik und starrer Materie, womit er das Verständnis der Realität, in die Geist und Sprache einwirken, verfehlt. Da hängt dann zu viel Wissen in der Außenwelt, die unabhängig von unserem Denken existiert.
Kerngedanke:
Wittgenstein lehnt die Idee einer objektiven Gewissheit, die unabhängig von unserem Sprachgebrauch und unseren Lebensformen existiert, ab. Ein universeller Zweifel existiert ebensowenig. Das Fehlen von Zweifel ist nicht gleichbedeutend mit positiver Gewissheit.
Für ihn sind mathematische Sätze nicht unbedingt Abbildungen von Realitäten oder außermenschlichen Wahrheiten, sondern vielmehr Ausdrücke von Regeln innerhalb eines bestimmten Sprachspiels (Wörter, Sätze, Aktivitäten, Praktiken, Lebensformen in denen Sprache verwendet wird).
Die für mich wichtigsten Aussagen:
•Überzeugungen bilden ein System/Gebäude
•Erfahrungssätze sind keine homogene Masse. Die Idee von der Übereinstimmung mit der Wirklichkeit findet keine klare Anwendung
•Was vernünftig ist, ändert sich. Als könnte sich mein Geist nicht auf irgendeine Bedeutung einstellen, weil ich die Einstellung nicht in Bereich suche wo sie ist. Gewisse Worte machen nur in gewissem Zusammenhang Sinn - Sinn durch Situation bestimmt
• Nur in System hat das Einzelne den Wert, den wir ihm beilegen.
• Mir kommt eine Art Weltanschauung in die Quere
Interessanter Gedanke ist, dass sich Gewissheiten durch unsere Handlungen ausdrücken. Das Wissen formt sich um unsere Taten und Handlungen. Diese können weder einfach abgelegt werden, noch sinnvoll bezweifelt werden.
Wittgenstein macht im Text gut klar, was an Moores Aussagen"ich weiß dass das ein Baum ist" so merkwürdig ist und weshalb Sprache eine bedeutende Rolle spielt. Dass er "ich weiß" davor setzt, bekommt die Aussage eine solch skurrile Selbstverständlichkeit, die nahezu nach skeptischem Zweifel bettelt.
Hab gelesen dass hier der Kontrastivismus geeignet sei. Wissenszuschreibungen die wahr sein können, sofern der inhärente Kontrast nicht skeptische Hypothesen aufweist, was u. a. dann geschieht, wenn eine Person mit ihren Behauptungen einen betont antiskeptischen Anspruch verbindet. Also der Satz von Moore müsste dann lauten: " ich weiß, dass das ein Baum ist, ehr als es ein Fahnenmast ist."