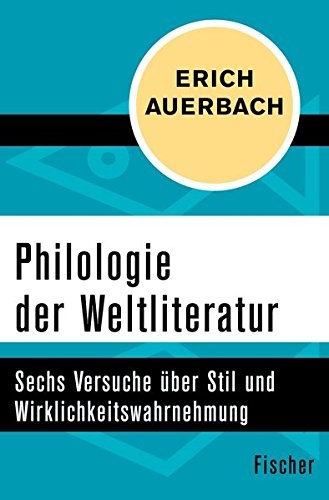AnnaCarina hat Philologie der Weltliteratur von Erich Auerbach besprochen
Review of 'Philologie der Weltliteratur' on 'Goodreads'
5 Sterne
Auerbach ist so dermaßen ansteckend begeisternd, wie ich es selten von einem Sachtext erlebe.
Man merkt wie sehr er für die Literatur und die umspannende Aufgabe der Philologie brennt.
Der Geist ist nicht national. Er macht sich stark für eine synthetische Philologie, die die Bewegung des Ganzen ergreift. Bewusstmachung der eigenen Geschichte.
Im folgenden ein paar Blitzlichter aus den einzelnen Betrachtungen:
Vergil und Dante
"Vergil gab Dante die Einfachheit des Stils.... Dante lernte von Vergil die Kunst des eigentlich dichterischen Gedankenausdrucks, in dem das Gedachte und poetisch zu Lehrende nicht mehr als ein sonderbares, die Dichtung störendes und lähmendes Fremdgebilde auftritt, sondern in das Mythisch-Dichterische eingeschmolzen und in der dichterischen Substanz selbst enthalten ist. "
Dantes Dankbarkeit gegenüber Vergil-> Worte die Beatrice spricht:
"Sie bedeutet die innere Würde, die stets bereit ist zum Guten, obgleich ihr verwehrt ist, seine Früchte zu genießen – denn Vergil ist ausgeschlossen vom Reich Gottes. …
Auerbach ist so dermaßen ansteckend begeisternd, wie ich es selten von einem Sachtext erlebe.
Man merkt wie sehr er für die Literatur und die umspannende Aufgabe der Philologie brennt.
Der Geist ist nicht national. Er macht sich stark für eine synthetische Philologie, die die Bewegung des Ganzen ergreift. Bewusstmachung der eigenen Geschichte.
Im folgenden ein paar Blitzlichter aus den einzelnen Betrachtungen:
Vergil und Dante
"Vergil gab Dante die Einfachheit des Stils.... Dante lernte von Vergil die Kunst des eigentlich dichterischen Gedankenausdrucks, in dem das Gedachte und poetisch zu Lehrende nicht mehr als ein sonderbares, die Dichtung störendes und lähmendes Fremdgebilde auftritt, sondern in das Mythisch-Dichterische eingeschmolzen und in der dichterischen Substanz selbst enthalten ist. "
Dantes Dankbarkeit gegenüber Vergil-> Worte die Beatrice spricht:
"Sie bedeutet die innere Würde, die stets bereit ist zum Guten, obgleich ihr verwehrt ist, seine Früchte zu genießen – denn Vergil ist ausgeschlossen vom Reich Gottes. Was er für Dante und damit für das Reich Gottes tut, das geschieht aus der von Einsicht und Bescheidenheit genährten cortesia, einer selbstlosen und ganz autonomen Größe des Herzens, die keinen Lohn erhofft als das eigene Bewußtsein und die Billigung der Guten. Mehr als irgendwer sonst in der Komödie verdankt er seine Einsicht und Tugend sich selbst; Mut und Milde des Herzens, Maß und Festigkeit des Urteils, königliche und zugleich demütige Weisheit bilden in ihm eine in jedem Wort und jeder Geste neu sich offenbarende väterliche Humanität; die Einfachheit eines Menschen, der die höchste Stufe menschlicher Bildung erreicht hat, dieselbe vollendete Einfachheit, die im vergilischen Werk uns bezaubert, hat Dante seinem Bilde Vergils gegeben, und darum ist es, trotz aller sonderbaren Züge mittelalterlichen Irrtums, im Innersten wahr."
Montaigne
Selbstkritisch, selbstironisch mit sympathischen Hochmut.
Er verteidigt seine innere Einsamkeit. Sein Leben ist sein Insich- und Beisichsein.
Keine Philosophie. Es fehlt das System. Ständiges Erwägen, Prüfen, Betrachten. Er macht sich selbst zum Gegenstand der Betrachtungen. Frei von Pathos. Phrasenlos.
Er ist Hedonist - liebt das Leben, Essen, Essen Trinken, Reisen, Wohnen, Besitz und Stellung.
Er überlässt sich Gewohnheit.
"der Strom des geschichtlichen Lebens umfängt ihn, und er läßt sich willig von ihm umfangen, wie der Schwimmer vom Wasser oder der Trinker vom Wein."
"Er taucht voll Wollust tief in den Gedanken des Todes. Aber er zittert nicht, und er hofft auch nicht. Er treibt sein Pferd an den Abgrund, bis es nicht mehr scheut – nicht gewaltsam mit Sporn und Peitsche, sondern sanft und unablässig mit dem Druck seiner Schenkel. So erschmeichelt er sich die Freiheit, ohne seine Knechtschaft zu vergessen, und immer durch die Erinnerung an sie den Genuß der Freiheit auskostend. So steht er einzig, für sich, bei sich, mitten in der Welt, und ganz allein."
Pascal
Er verhandelt das Verhältnis von Gewohnheit und Macht.
"Von Montaigne übernahm Pascal, zuweilen wörtlich, daß in den Gesetzen nicht Vernunft oder auch nur natürliche Übereinstimmung aller Menschen herrsche, sondern lediglich Gewohnheit. Diese sei aber abhängig von Ort und Zeit und schwanke daher beständig."
Er hatte sich dem extremen Augustinismus angeschlossen -> die Welt ist grundsätzlich böse.
"die Einrichtung der Welt ist Wahnsinn und Gewalt; der Christ hat dem Wahnsinn zu gehorchen, darf keinen Finger rühren, um ihn zu bessern; denn daß Wahnsinn und Gewalt herrschen, ist Gottes Wille, ist die echte Gerechtigkeit, die wir verdienen; der Triumph des Wahnsinns und der Gewalt, der Triumph des Bösen auf Erden ist Gottes Wille."
In Grundzügen steht er Hobbes und Machiavelli nah. Allerdings mit dem großen Unterschied, für ihn existierte kein dynamisches Leben des Staates. Er hatte kein Interesse am besten Staat, da alle gleich schlecht sind. Die reine böse Macht, der man widerspruchslos nur aus Hingabe zu Gott gehorchen muss.
Giambattista Vico
Er interpretiert die Mythen und versucht eine geistige Struktur der Menschen nachzuvollziehen.
Er sah den geschichtlichen Menschen ganz, und er sah, daß er selbst ein Mensch war, ihn zu verstehen. Er formte ihn nicht nach dem eigenen Bilde; er entdeckte nicht sich selbst im Anderen, sondern den Anderen in sich selbst: er entdeckte sich selbst, den Menschen, in der Geschichte, und längst verschüttete Kräfte unseres Wesens wurden ihm enthüllt. Das ist seine Humanität; etwas weit Tieferes und Gefährlicheres als das, was man zumeist unter diesem Worte versteht. Aber trotzdem, oder gerade deshalb, entdeckte er das Gemeinsame des Menschlichen, und hielt es fest.
Rousseau
Und das Problem der Entchristlichung. Ein Jahrhundert arm an seelischer Tiefe und sinnlicher Innerweltlichkeit.
Drang nach Selbstverachtung. Eine grundböse Welt.
"Die Welt ist verdorben – sie hat etwas verloren, was unwiederbringlich ist, und ihre ursprüngliche Reinheit ist für ewig verspielt. Nie hat Rousseau gehofft, sie durch die Maßregeln, die er forderte, wieder gewinnen zu können..."
Christentum ist für ihn nur noch Dogma.
"Daß ein Mensch ihrer Art, in Europa geboren, durchtränkt von Demut, Weltflucht, Begierde nach Buße und Erlösung, in keiner christlichen Kirche mehr Raum fand, daß er auch keine neue christliche Kirche gründete, daß in den Ausbrüchen seiner Verzweiflung und seiner Hoffnung kein Wort zu finden ist von dem Leiden Christi, vom Sündenfall und vom Jüngsten Tag – das scheint mir für die Wendung Europas in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts entscheidend."
Nachtrag:
Meine 5 Sterne Begeisterung hängt evtl. mit meiner Unkenntnis zusammen. Ich vermute, wer bereits etwas mit der Philologie vertraut ist und sich mit den entsprechenden Herren auseinander gesetzt hat, wird vielleicht nur den ein oder anderen netten Gedankengang für sich erhaschen.
Wahrscheinlich sind die Betrachtungen zu kurz, um jemandem mit Vorwissen in Begeisterungsstürme ausbrechen zu lassen.
Als Einstiegslektüre ist das hier genau das Richtige.