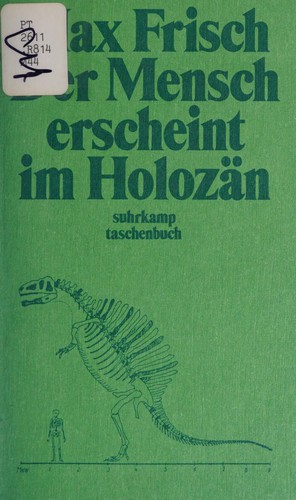AnnaCarina hat Der Mensch erscheint im Holozän von Max Frisch besprochen (Suhrkamp Taschenbucher -- 734)
Review of 'Der Mensch erscheint im Holozän' on 'Goodreads'
5 Sterne
Der Mensch erscheint im Holozän liest sich wie eine Meditation.
Ruhig, dicht, nachdenklich, fragmentiert.
Einer der vielen Ausschnitte des Wissens – der Anti-Vergesslichkeit Geisers, die im Wohnzimmer hängen, seinem Rettungsseil, das er sich selbst hinwirft, um die Wand zu erklimmen – besagt:
Mensch: geschichtliches Wesen
Formung über Künste, Wissenschaften, Sitten
Produktive Phantasie, Wille
Nur der Mensch hat Zukunft
Lebt nicht eingepasst in eine Umwelt, nicht angepasstes Verhalten möglich – Irrwege, Fehlentwürfe, Fehlentscheidungen
Weite Gebiete der Erdoberfläche hat er für seine Bedürfnisse umgestaltet; der Anteil der Kulturlandschaft nimmt ständig zu.
Dass Max Frisch in diesem Spannungsfeld des Nicht-Angepasst-Seins lebte, ist bekannt. Das Bedürfnis nach Unabhängigkeit und Selbstbestimmung durchlebt Geiser auf seiner Wanderung in die Berge.
Frisch greift ein doppeltes Motiv auf: Natur und Gesellschaft.
Der Grundtenor des Buches ist die Entfremdung und Verletzlichkeit, Verwundbarkeit des Menschen gegenüber der Natur.
Ein weiterer Schnipsel seines Wissens sagt:
Umgestaltung des Erdbildes, durch sie werden …
Der Mensch erscheint im Holozän liest sich wie eine Meditation.
Ruhig, dicht, nachdenklich, fragmentiert.
Einer der vielen Ausschnitte des Wissens – der Anti-Vergesslichkeit Geisers, die im Wohnzimmer hängen, seinem Rettungsseil, das er sich selbst hinwirft, um die Wand zu erklimmen – besagt:
Mensch: geschichtliches Wesen
Formung über Künste, Wissenschaften, Sitten
Produktive Phantasie, Wille
Nur der Mensch hat Zukunft
Lebt nicht eingepasst in eine Umwelt, nicht angepasstes Verhalten möglich – Irrwege, Fehlentwürfe, Fehlentscheidungen
Weite Gebiete der Erdoberfläche hat er für seine Bedürfnisse umgestaltet; der Anteil der Kulturlandschaft nimmt ständig zu.
Dass Max Frisch in diesem Spannungsfeld des Nicht-Angepasst-Seins lebte, ist bekannt. Das Bedürfnis nach Unabhängigkeit und Selbstbestimmung durchlebt Geiser auf seiner Wanderung in die Berge.
Frisch greift ein doppeltes Motiv auf: Natur und Gesellschaft.
Der Grundtenor des Buches ist die Entfremdung und Verletzlichkeit, Verwundbarkeit des Menschen gegenüber der Natur.
Ein weiterer Schnipsel seines Wissens sagt:
Umgestaltung des Erdbildes, durch sie werden Pflanzen und Tiere zur Anpassung an neue Lebensverhältnisse, zur Wanderung oder zum Untergang gezwungen.
Deshalb muss Geiser wandern. Allein. Auch im Nebel. Es ist nass, glitschig, widrig. Das ewige Rutschen. Die Risse. Die Erosionen. Aber frei.
Das Unwetter im Buch hat Stromausfälle und Erdrutsche zur Folge. Die Turmuhr steht still.
Kultur? Ein paar Jungs in der Kneipe:
Die Burschen haben ihren lauten Spaß; die Erosion, die draußen stattfindet, bekümmert sie überhaupt nicht.
Frisch verdichtet alles auf die Isolation Geisers und den Verlust der Zeit als Ankerpunkt. Die Einzelempfindungen von Moment zu Moment geben den Takt vor. Regen, Nebel und „Lavendel ohne Duft, wie in einem Farbfilm“. Sonne und sinnliche Momente sind verbraucht. Frisch erzeugt einen drückenden, stillen Raum der Zeit. Während in Mrs. Dalloway Zeit als Orientierungspunkt dient, der Gegenwart und Vergangenheit verbindet, setzt Frisch das Klingeln und die Glockenschläge aus.
Geiser ist völlig auf sich selbst zurückgeworfen. Allein. Verwitwet, mit schwindendem Gedächtnis. Seine Beschäftigung mit den Erdzeitaltern lässt das menschliche Leben fragil und bedeutungslos erscheinen.
Geisers Ich, steht symbolisch für die Natur und Landschaft. Sie verschmelzen ineinander.
Das Rutschen. Die Risse. Die Erosionen (schädigt bei Kahlschlag und übermäßiger Nutzung). Der Nebel.
Geiser sieht aus wie ein Lurch. Geiser mag keine Feuersalamander. Transformiert er sich durch seinen Gedächtnisverlust in ein instinkthaftes, kleinhirniges Dasein einer Echse oder eines Dinosauriers? Nein, er wehrt sich. Er hat den Willen. Hat sein Wissen. Seine Zettel. Seine Erinnerung. Der Mensch ist ein geschichtliches Wesen. So steht es auf dem Zettel. Warum hat er einen Hut auf dem Kopf? Er hat die Streichhölzer vergessen.
Das doppelte Motiv: nicht angepasstes Verhalten, das Bedürfnis nach Nähe und die Angst vor dem Verlust der Freiheit, hat Frisch zeitlebens beschäftigt. Menschliche Bindungen – welche Sicherheit können sie mir bieten? Geiser sieht sich existentiellen Bedrohungen ausgesetzt. Das Rutschen. Die Risse. Die Natur, die Erde – wie können sie ein für alle Mal gesichert sein, damit ich es wagen kann, mich um Gesellschaft und Beziehungen zu kümmern?
Geiser erinnert sich an seinen Bruder. Das Seil. Der Berg. Vertrauen und Verlässlichkeit. Geiser wehrt sich im Jetzt gegen das Seil der anderen. Er wirft sich sein eigenes Seil – zu kurz und brüchig. Er klettert ohne Halt. Die Brille ist auch kaputt.
Corinne kommt vorbei. Knäckebrot ist noch da.