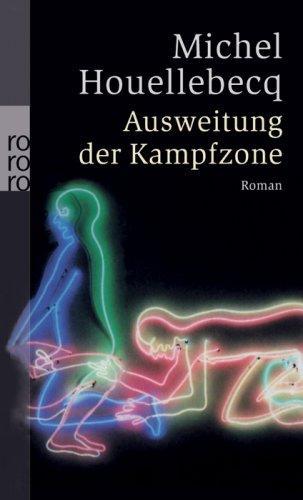AnnaCarina hat Ausweitung der Kampfzone von Michel Houellebecq besprochen
Review of 'Ausweitung der Kampfzone' on 'Goodreads'
3 Sterne
Update
Zum Reread hat sich ein neuer Aspekt hinzugesellt- der Wunsch nach klaren Strukturen, Verlässlichkeiten, Bedeutungszuschreibungen, die sich im Verhalten ausdrücken.
Die Leere der sozialen Codes.
Der Icherzähler sieht sich in einem uferlosen Meer voller Ungewissheiten, chaotischer, oberflächlicher Abläufe und Gleichgültigkeit.
„ stattdessen herrscht überall Anarchie, die Programme sind auf x-beliebige Weise heruntergeschrieben, jeder sitzt in seiner Ecke und macht, was er will, ohne sich um die anderen zu scheren, es gibt keine Verständigung, es gibt keinen gemeinsamen Plan, es gibt keine Harmonie, Paris ist eine grauenhafte Stadt, die Leute kommen nicht mehr zusammen, sie interessieren sich nicht einmal für ihre Arbeit, alles ist oberflächlich, jeder geht um sechs Uhr nach Hause, ob die Arbeit erledigt ist oder nicht, das alles ist ihnen scheißegal.“
Houellebecq lässt den depressiven Icherzähler in ironischer Distanznahme, nüchtern und urteilend, sich selbst mit dekonstruierend, durch einzelne szenische Mitschnitte strunkeln.
Die erste Hälfte ist noch stark …
Update
Zum Reread hat sich ein neuer Aspekt hinzugesellt- der Wunsch nach klaren Strukturen, Verlässlichkeiten, Bedeutungszuschreibungen, die sich im Verhalten ausdrücken.
Die Leere der sozialen Codes.
Der Icherzähler sieht sich in einem uferlosen Meer voller Ungewissheiten, chaotischer, oberflächlicher Abläufe und Gleichgültigkeit.
„ stattdessen herrscht überall Anarchie, die Programme sind auf x-beliebige Weise heruntergeschrieben, jeder sitzt in seiner Ecke und macht, was er will, ohne sich um die anderen zu scheren, es gibt keine Verständigung, es gibt keinen gemeinsamen Plan, es gibt keine Harmonie, Paris ist eine grauenhafte Stadt, die Leute kommen nicht mehr zusammen, sie interessieren sich nicht einmal für ihre Arbeit, alles ist oberflächlich, jeder geht um sechs Uhr nach Hause, ob die Arbeit erledigt ist oder nicht, das alles ist ihnen scheißegal.“
Houellebecq lässt den depressiven Icherzähler in ironischer Distanznahme, nüchtern und urteilend, sich selbst mit dekonstruierend, durch einzelne szenische Mitschnitte strunkeln.
Die erste Hälfte ist noch stark von der Arbeitswelt geprägt und erinnert immer wieder an Kafka und seine Entfremdung zu ihr.
Die zynische Reflexion verweilt narrativ in einem Abschottungsmechanismus. Das liest sich für mich nur kurzweilig interessant und verliert sich doch schnell in Redundanzen.
Er bleibt für meinen Geschmack zu lange in einzelnen Szenen, fügt ihnen nichts hinzu, lamentiert rum.
Ironische Distanz geht für mich erzählerisch nur dann auf, wenn sie eine suchende Bewegung in der Sprache und Stilistik aufweist. Dh. Türen öffnet, kreativ und dynamisch genutzt wird und Möglichkeitsräume schafft.
Wenn ein Autor sich dazu entschließt, sich an der symbolischen Ordnung abzuarbeiten - an Werten, Normen, Codes - und dabei den Icherzähler mit Hasskappe auf die Psychoanalyse, sich dem Realen, dem Unmöglichen verweigern lässt und das Imaginäre nicht ausschöpft, wird die Luft dünn. Das Unmögliche wird durch Ohnmacht kaschiert.
„Von den Sturmhöhen haben wir uns weit entfernt, das ist das Mindeste, was man sagen kann. Die Romanform ist nicht geschaffen, um die Indifferenz oder das Nichts zu beschreiben; man müsste eine plattere Ausdrucksweise erfinden, eine knappere, ödere Form.“
Na, und diese öde Form gelingt ihm auf den ersten 70% Teilstrecke des Buches nicht sonderlich.
Klar, sie eignet sich hervorragend die Verbitterung, Leere und Hoffnungslosigkeit dieser Gestalten zu unterstreichen. Sie eignet sich aber nicht, um ein erzählerisch, in sich stimmiges literarisches Werk abzuliefern. Dafür sind die Szenen viel zu lose miteinander verknüpft und werden rein informativ abgearbeitet. Ein zynischer Spruch jagt den nächsten. Aburteilen. Weiter.
Das letzte Drittel hatte ich sehr stark in Erinnerung. Und das habe ich auch diesmal wieder zu empfunden. Der Text schließt sich zu erzählerischen Erlebnissen zusammen. Es fließen Emotionen ein. Die Dramatik nimmt zu und der Icherzähler wechselt in eine innere Dynamik. Das Imaginäre wird jetzt gut bespielt. Bilder weben sich ein, Raum erschließt sich.
In diesem Werk ist mir der Inhalt, der verhandelt wird, tatsächlich mehr Wert als die Ausführung.
Daher ziehe ich nur einen Stern von meiner Ursprungsbewertung ab.
Die Verknüpfung der Verwirrung, die Menschen erleben, die sich sehr stark an Strukturen und Verlässlichem orientieren müssen und auf Widerstände stoßen, hier insbesondere Verhaltensweisen vs. Sozialem Code in Bezug auf Sexualität, finde ich inhaltlich sehr gut dargestellt.
Menschen die nach einer Symbolisierung oder Bedeutungszuschreibung lechzen, die ihnen ständig entzogen wird. Und oben drauf, entfernen diese sich selber in ihrem Symbolisierungswahn, völlig abstruse Urteile und Bedeutungen zuschreibend, immer weiter von ihrem sozialen Umfeld.
Die Ohnmacht des Realen wird sehr gut durch das Unvermögen an einen Sexualpartner zu kommen dargestellt.
Natürlich ist der Icherzähler ein Kacksack. Aber einer mit einem Anliegen, das ich sehr ernst nehme.
................................................................
................................................................
Ursprungsrezension: 4,5⭐️
Moah, welch morbides Buch. Da hat er aber als Erstlingswerk einen rausgewemst.
An alle die sich gerade in keiner gefestigten Gemütslage befinden: Dieses Buch könnte Euch noch tiefer in den Abgrund ziehen.
Noch nie über Depression in dieser nüchternen, analytischen und hoffnungslosen Form gelesen.
In der ersten Hälfte des Buches wusste ich nicht so recht wo Houellebecq hin will, was das alles soll. Passagenweise zitiert der Icherzähler andere Werke, von denen ich nix geschnallt hab. Er driftet immer wieder in total verintellektualisiertes Gefasel ab.
Und dann kommen Passagen in denen ich lauthals Lachen musste, so absurd, tragisch komisch schildert er die Szenen.
Ich habe ihn so dafür gefeiert unattraktive Menschen auf den Plan zu rufen. Nun ja, die Feierstimmung verging mir dann im letzten Drittel gründlich.
Hier hat er meisterhaft die Depression, den Wahnsinn der Gesellschaft, die Gewinner und Verlierer der sexualisierten Gesellschaft verarbeitet.
Eine tiefe Sinnlosigkeit breitete sich aus. Da war ich doch kurz an Camus „Der Fremde“ erinnert.
Viele andere Szenen erinnerten mich an „Faserland“ von Christian Kracht.
Kurzum: ich bin begeistert und will mehr von diesem Wahnsinnigen lesen!!!